Im Jahr 1992 machte der Fundamentaltheologe Johann Baptist Metz in seinem Buch «Glaube in Geschichte und Gesellschaft» darauf aufmerksam, dass die Kultur der Erinnerung eine wesentliche theologische Aufgabe sei. Aus diesem Blickwinkel sind die folgenden Gedanken geschrieben – aus der Sicht eines Theologen, nicht aus der Sicht eines Historikers.
Der jüdische Kalender kann ein ausgezeichnetes Beispiel sein, um darzulegen, wie religiöse Erinnerungskultur gestaltet ist; die religiösen Feste, die im Verlauf des Jahres zu feiern sind, nehmen laufend Bezug auf die eigene Geschichte des Volkes Israel. Eine der wichtigsten Erzählungen wird anlässlich des Pessach-Festes im Kreis der Feiernden vorgetragen: der Auszug aus dem Sklavenhaus, die Befreiung aus Ägypten. Wer am Pessach-Fest teilnimmt, wird durch die Riten und die lebendig erzählte Geschichte direkt hineingezogen in das Geschehen des Auszuges. Eine gewisse Identifikation der Feiernden mit dem Exodus-Geschehen ist die Folge. Die Feier des Pessach-Festes kann eine individuelle und eine kollektive Identität erzeugen – die Zugehörigkeit der Einzelnen wird über diese spezifische Art der Erinnerungskultur gefördert.
Historiker melden Zweifel an, inwieweit der Exodus, der religiös so bedeutende Auszug aus Ägypten, historisch nachweisbar ist. Es gibt zunehmend die Tendenz anzunehmen, dass es sich bei der Schilderung dieses Ereignisses nicht um reine Geschichtsschreibung handeln könne. Der Heidelberger Professor Jan Assmann spricht in dem Zusammenhang von einem «Gedächtnisgeschichtlichen Ansatz», der nicht mehr danach fragt, «wie es eigentlich gewesen ist», sondern vielmehr, «wie es erinnert wurde». Der von Assmann geprägte Begriff des «kulturellen Gedächtnis» ist umfassender als eine bloss historische Faktensammlung. Kultur und Identität einer Gesellschaft oder Gemeinschaft erwachsen aus der eigenen Geschichte; wobei diese immer neu gedeutet und in der Gegenwart immer neu aktualisiert wird.
Die religiös geprägte Kultur der Erinnerung und die Historiographie kommen also bezüglich des Exodus zu divergierenden Schlüssen. In welchem Verhältnis stehen die beiden Sichtweisen zueinander?
Yoseph H. Yerushalmi zeigt in seinem Buch «‹Zachor›: Erinnere Dich! Jüdische Geschichte und jüdisches Gedächtnis» auf, wie Erinnerungskultur und Historiographie im jüdischen Kulturraum zusammenwirken. Die Historiographie bemüht sich in ihrer Forschung, eine möglichst präzise Rekonstruktion des historischen Sachverhaltes zu ermöglichen. Die Erinnerungskultur ihrerseits liefert eine Deutung, sie vermittelt die Bedeutung von historischen Ereignissen für die Gemeinschaft.
Historiographie und deutende Erinnerungskultur stehen also in einem nicht immer spannungsfreien Dialog. «Die Erinnerung ist angewiesen auf die historisch-kritische Reflexion; die Historiographie mündet in deutende Orientierung». So formuliert das Reinhold Boschki.
Was bezüglich des Spannungsfeldes «Erinnerung – Historiographie» in der jüdischen Religion gilt, das kann ebenso im Christentum beobachtet werden. Die historisch-kritische Methode der Geschichtswissenschaft kommt bei ihren Forschungen nicht immer zu den gleichen Schlüssen wie die Erinnerungskultur oder gar die Volksfrömmigkeit. Es besteht die Dringlichkeit eines offenen Dialoges. Es zeigt sich die Notwendigkeit der gegenseitigen Anerkennung und Wertschätzung.


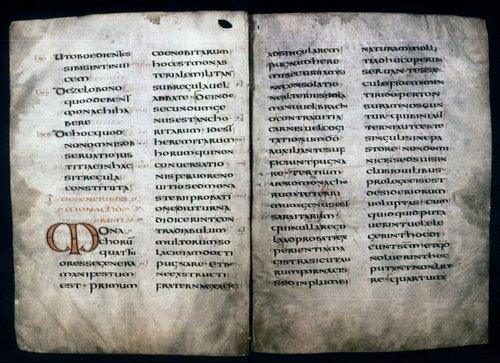
Kommentare und Antworten
Bemerkungen :
Meines Erachtens muss man zwischen den verschiedenen Orden unterscheiden. Bei Dominikanern, Zisterziensern und Benediktinern gehört die Ordenstracht nun mal zum Erscheinungsbild in der Oeffentlichkeit, wohingegen etwa die Jesuiten und zum Beispiel die Pallotiner, etwa die von Gossau SG, schon immer Ordensleute in der Welt waren, was sich auch auf die Kleidung ausgewirkt hat. Der Pater, der jeweils am 15. August auf der Alp Brüdern im Entlebuch seit vielen Jahren die Bergmesse liest, reist stets "in Zivil" an, wobei aber selbstverständlich die Messe in einem mitgebrachten Gewand samt Stola usw. zelebriert wird. Die Messe an jenem Muttergottestag auf der Alp wird übrigens seit 1590 gefeiert in einer Kapelle, für die seit vielen Generationen die gleiche Älplerfamilie zuständig ist. Seit Jahren besteht die musikalische Begleitung aus einem Jodler-Ehepaar; die historische Glocke zeigt noch ein Bild von St. Joder, dem Wetterheiligen, sowie St- Niklaus, dem Passheiligen und ausserdem dem Kirchenvater Augustinus.
Die Ausführungen über Historiographie und Erinnerungskultur oben bleiben bedenkenswert. Interessanterweise berufen sich die Begründungen der Mariendogmen von 1854 durch Papst Pius IX. und 1950 durch Papst Pius XII. sehr stark auf die Erinnerungskultur, was aus protestantischer Sicht anfechtbar zu sein scheint, aber nicht aus religionsgeschichtlicher Perspektive: Abendmahl und Messe waren in ihrer Feier schon immer Erinnerungskultur, "tut dies zu meinem Andenken!". Erinnerungskultur ist nicht alles, aber es gibt keine Liturgie ohne Erinnerungskultur. Nur wäre es eine Verkürzung, die Messe mit Erinnerungskultur schlechthin gleichzusetzen. Selbst und gerade Zwingli war klar, dass während der Abendmahlsfeier aktuell "etwas passiert", nämlich unter den Gläubigen, was er aber nicht mit der aktuellen Verwandlung von Brot und Wein verwechselt haben wollte. Dass "aktuell etwas passiert", gehört zum Geheimnis der Messe; wenn "nichts passiert" unter den Gläubigen, kann man es fürwahr bleiben lassen. Die sakralen Symbole sind dazu nicht Selbstzweck, sondern sollen auf dieses Geheimnis hinführen. Sonst würde es sich um "Theater" handeln. Auch die Gewandung des Priesters steht in diesem Zusammenhang, wobei aber zB. Ordensbrüder keine Priester sein müssen. Einen Spezialfall stellten vor ein paar Jahrzehnten die sog. Arbeiterpriester dar. Ich stelle mir indes vor, dass Sie am Kragen oder sonstwie an ihrer Kleidung zumindest einen sakralen Symbolgegenstand angeheftet hatten. Die Krawatte ist iistorisch eine Abgrenzung sowohl gegen den Adel als auch gegen den Stand des Klerus und Distanzierung vom Proletariat, also Bekenntnis zum Bürgertum. Pater Muff möchte wohl mit seinem Erscheinungsbild sich mutmasslich aber vor allem vom Standesdenken abgrenzen, vgl. ja auch dasselbe unter den Frauen von früher: Mädchen, Jungfrauen, Ehefrauen, Witwen, Klosterfrauen repräsentierten unterschiedliche Stände, was sich in Kleidung, Kopfbedeckung usw. Ausdruck verschaffte. Es handelt sich hier um Feststellungen, nicht um Kritik.
Gott zum Gruss!
Von historisch-kritisch ist umso mehr die Rede, je kleiner die Zahl der Leute ist, welche noch die alten Sprachen beherrschen. Also zitiert man Sekundärliteratur, statt die Originale zu lesen oder generell die alten Geschichtsschreiber , Evangelisten und Paulus inbegriffen. Sicher ist, dass die Beziehungen Ägypten - Israel schon immer elementar waren, Ägypten eine alte Kultur hatte auch die Verschriftlichung betreffend. Die Kritik am Auszug aus Aegypten lässt sich schon bei Goethe nachlesen, in seinen Noten und Abhandlungen zum westöstlichen Divan, bei welchen er wohl mit Recht die 40 Jahre dieses Auszugs relativierte und die Proportionen herstellte, vgl. auch schon die Altersangaben von Propheten und Patriarchen im Alten Testament. Dies ändert aber nichts an der Historizität des grundsätzlichen Geschehens, am ägyptischen Einfluss usw., kann man ja bis zum Kult der Jungfrauengeburt verfolgen usw. Wer auch nur das Neue Testament im Original liest, dem fällt auf, dass durchaus das Niveau griechischer und römischer Geschichtsschreiber feststellbar ist und die Verfasser nicht als Märchenerzähler abgetan werden können; so wie noch im Weissen Buch von Sarnen, wo zwar Irrtümer nachweisbar sind, trotzdem der Verfasser in vielem ein Wissen hatte, wie es kein heutiger Historiker für sich behaupten kann; insofern sind zum Beispiel Flurnamen und Rechtsverhältnisse, z.B. die Haltungsbedingungen für Ochsen und dergleichen, realer Ausdruck der damaligen feudalen Ordnung, auch das Frauenbild steht bereits auf dem Niveau der Nachrichten z.B. über Dorothea, der Frau von Bruder Klaus, etwa im Satz "Frauen geben kalte Räte", was zugleich Kritik und Kompliment an den damaligen Frauen ist, die übrigens keineswegs einflusslos waren, da ist die Geschichte der Stauffacherin auch kein Märchen, eher schon eine exemplarische Erzählung. Die Geschichte sind noch lange so ernst zu nehmen wie das, was wir vielfach in der Tagesschau vom Geschehen etwa im Deutschland oder rund um die Ukraine erfahren, vieles ist nur vom Hörensagen und wird nachgeplappert.